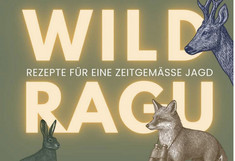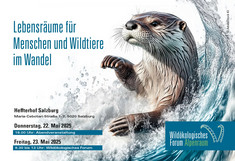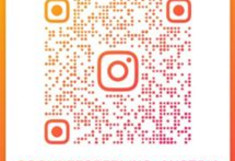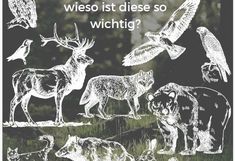IWJ - Aktuell
"Naturschutz versus Jagd: Kann Jagd angewandter Naturschutz sein?"
Diesem kontrovers diskutierten Thema widmet sich die neuesten Podcastfolge des Südtiroler Jagdverbandes "Wild Ragu - Rezepte für eine
zeitgemäße Jagd". Benedikt Terzer, GF des Südtiroler Jagdverbands, und Univ.Prof Dr. Klaus Hackländer geben Einblicke aus ihren Erfahrungen.
Jetzt überall, wo es Podcasts gibt, oder hier:
https://jagdverband.it/podcast/
Planet Shapers podcast über Wildtiere und Klimawandel
Wien, 22. Jänner 2026
„Was dem Klimaschutz dient, kann für Wildtiere Barrieren und Risiken schaffen. Umso wichtiger ist es, gute Kompromisse zwischen Energiegewinnung und Naturschutz zu finden", so IWJ-Leiter Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer in der aktuellen Folge der Podcast-Serie Planet Shapers der BOKU University, bei der es darum geht, wie Klimaschutz, Artenschutz und die Nutzung unserer Lebensräume miteinander vereinbar sind. Jetzt überall, wo es podcasts gibt oder hier: https://boku.ac.at/oeffentlichkeitsarbeit/planet-shapers
Die natürliche Ausbreitung des Wolfs in Österreich schreitet voran – wo gibt es ökologisches Lebensraumpotenzial und wo könnten Konflikte entstehen?
Wien, August 2025:
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts LeKoWolf zeigen das Lebensraum- und Konfliktpotenzial für Wölfe in Österreich auf. In einem wissenschaftlichen Team des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft (IWJ) der BOKU Wien, bestehend aus Dr. Florian Kunz, Fabian Knufinke MSc. , Dr. Jennifer Hatlauf und Univ. Prof. Klaus Hackländer wurde in den letzten Jahren intensiv an dem Thema gearbeitet. Ziel des LeKoWolf-Projekts war es, Gebiete mit hoher ökologischer Eignung für Wölfe und gleichzeitig geringem bzw. hohem Konfliktrisiko zu erkennen und Hotspots beider Potenziale räumlich auf Karten darzustellen. Damit kann das Projekt wissenschaftliche Grundlagen für ein fundiertes Wolfsmanagement liefern und die Koexistenz von Mensch und Wolf durch datenbasierte Entscheidungsgrundlagen unterstützen.
Link zu den FAQs zum Projekt:
oder https://dafne.at/projekte/lekowolf
Auszeichnung der diesjährigen neuen 21 Akad. Jagdwirt*innen und GRANSER-Forschungspreis für eine nachhaltige Jagd an zwei junge Wissenschaftlerinnen in einer gemeinsamen Akademische Feier an der BOKU University Wien
-
 2 Bilder
2 BilderUnsere neuen 21 Akad. Jagdwirt*innen der BOKU University aus Österreich, Deutschland und der Schweiz 2025 1. Reihe v.l.vn.r.: VRin Assoc.Prof. Dr. Doris Damyanovic, Dietmar Kalkhauser, René Hartwig MA, Martin Butz, Beat Angerer, Mag. Marion Kranabitl-Sarkleti, Jakob Lipp, Franz Preitler, Tobias Bernecker, Mag. Dominik Bischof LLM, MBA, MA, Hannes Brandenberg, Mag. Christine Thurner 2. Reihe v.l.n.r.: Dr. Florian Kunz, Dipl.-Ing. Lukas Wojtosiszyn, Karl Reiter, Dipl.-Ing.(FH) Herbert Ecker MSc, MBA, Hendrik Engelmann LLM, MBA, Ing. LJM-Stv. Johannes Unterhalser, Dipl.-Ing. Peter Klade, Mag. Peter Lennkh, Walter Mahnert, Matthias Goll, Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer -
 2 Bilder
2 BilderDie diesjährigen Granser-Forschungspreisträgerinnen für eine nachhaltige Jagd 2025 v.l.n.r.: Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer, VRin Assoc.Prof. Dr. Doris Damyanovic, Dr. Jennifer Hatlauf, Dr.. Stephanie Wohlfahrt, Dr. Ulrich Granser, Ehem. Rektor Univ.Prof. Dr. Hubert Hasenauer
Wien, am 5. Dezember 2025 – Feierliche Abschlusszeremonie des Universitätslehrgangs Jagdwirt*in für 21 Akad. Jagdwirt*innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an der BOKU University
Utl: Verleihung des Granser-Forschungspreises für nachhaltige Jagd an zwei herausragende Wissenschaftlerinnen.
Wieder wurde im Rahmen einer gemeinsamen feierlichen Akademischen Feier an der BOKU University Wien in den altehrwürdigen Festsaal des Gregor-Mendelhauses geladen: Gleich 21 Akad. Jagdwirt*innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz feierten den festlichen Abschluss ihres berufsbegleitenden Universitätslehrgangs Jagdwirt*in und nahmen voll Stolz Urkunden und Jagdwirte-Pins bzw. Hutnadeln entgegen. „Die Ansprüche der Land- und Forstwirtschaft, die Wertevorstellungen unserer Gesellschaft und die Bedürfnisse der Wildtiere in Einklang zu bringen erfordert lebenslanges Lernen, statt unreflektiertem Festhalten an Traditionen“, betonte Univ.Prof. Hackländer in seiner Ansprache. Auch die Themen der Abschlussarbeiten der Absolventen des Universitätslehrgang Jagdwirt*in machen das breite Spektrum der wissenschaftlichen Auseinandersetzung der frischgebackenen Akad. Jagdwirt*innen der BOKU sichtbar: Von wildbiologischen, medizinischen, juristischen, ballistischen, gesellschaftspolitischen bis hin zu wirtschaftlichen Themen. In der anschließenden Zusammenfassung finden Sie einen kurzen Abriss der im Rahmen der Feier präsentierten Abschlussarbeiten. Alle Arbeiten sind auf www.jagdwirt.at zum vollständigen Download verfügbar.
Ein großes Geheimnis wurde allerdings erst vor Ort gelüftet: Tobias Bernecker MA aus Wien ist der verdiente Jahrgangsbeste und nahm als solcher eine neue Steelaction im Kaliber .308 entgegen, ein Geschenk des Kooperationspartners jagdschein.at, welche seit Jahresbeginn mit dem Universitätslehrgang Jagdwirt*in besteht.
Wie schon die Jahre zuvor feierte man in diesem Rahmen auch die Überreichung eines jagdlich relevanten Forschungspreises - dem „Granser-Forschungspreis für nachhaltige Jagd“ - die die BOKU University gemeinsam mit der GRANSER - United Global Academy jedes Jahr für herausragende wissenschaftliche Publikationen der vergangenen zwei Jahre ausschreibt. Prämiert werden Studien bzw. deren Autor*innen, die einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung von Managementstrategien im Sinne einer nachhaltigen Jagd leisten. Im Jahr 2025 sind dies die Preisträgerinnen Dr. Jennifer Hatlauf für ihre Studie „A stage-based life cycle implementation for individual-based population viability analyses of grey wolves (Canis lupus) in Europe“ und Dr. Stephanie Wohlfahrt für ihre Studie “Exploring the use of REM in compact hunting grounds – comparing site specific to average parameters”.
Wir gratulieren den Akad. Jagdwirt*innen des 16. Jahrgangs und den Granser-Preisträgerinnen 2025 ganz herzlich!
Gesamtes Dokument zum Download als PDF
IWJ im Parlament
Wien, 1. Dez. 2025
Auf Einladung des Nationalratsabgeordneten Johann Höfinger war das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft im Österreichischen Parlament für eine Aussprache zum Thema Jagd und Natur zu Gast.
Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer
Institutsvorstand
BOKU University
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft
Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität
Dem Geschlechterverhältnis von Rotwildbeständen auf der Spur
Der Klimawandel setzt Europas Wäldern stark zu, weshalb vielerorts die Bestände des wiederkäuenden Schalenwilds entsprechend den neuen Lebensraumtragfähigkeiten und Wildschadensanfälligkeiten angepasst werden müssen. Für eine nachhaltige und weidgerechte Regulation sind Kenntnisse über Dichte, Altersstruktur und das Geschlechterverhältnis entscheidend.
Eine Studie von Stephanie Wohlfahrt und Kollegen untersuchte, wie sich verschiedene statistische Methoden auf die Bestimmung des Geschlechterverhältnisses von Rotwild mithilfe von Wildkameras auswirken.
Das Ergebnis: Aufwendige Modellierungen lieferten ähnliche Resultate wie einfache Auswertungen. Somit können Wildtiermanager künftig mit geringem Aufwand zuverlässige Daten gewinnen.
Die Studie wurde im Fachjournal Journal of Wildlife Management veröffentlicht: https://doi.org/10.1002/jwmg.70139
Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer
BOKU University
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft
Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität
Lausche der Natur – Ein Podcast über die akustische Vielfalt unserer Umwelt
Wien, 27. Oktober 2025
Die Natur ist voller faszinierender Stimmen und Klänge – von zwitschernden Vögeln bis hin zu summenden Insekten. Doch was können uns diese Geräusche über die Artenvielfalt und den Zustand unserer Umwelt verraten? Im Podcast von Daniela Lipka und Hartmut Schnedl tauchen wir ein in die Welt des passiven akustischen Monitorings und erfahren, wie Technik und künstliche Intelligenz dabei helfen, die Natur besser zu verstehen und zu schützen.
Eva Maria Schöll vom Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien gibt spannende Einblicke in ihre Forschung auf Streuobstflächen in Österreich und zeigt, wie akustische Forschung einen Beitrag zum Naturschutz leisten kann.
Hören Sie rein und lassen Sie sich von der Klangwelt der Natur inspirieren! http://www.flaneurunddistel.at/koennen-mikrofone-artenvielfalt-retten/
Informationen zum Projekt DivMoSt: https://forschung.boku.ac.at/de/projects/15732
Wissenschaftlicher Kontakt: Eva Schöll (eva.schoell(at)boku.ac.at)
Foto Hausrotschwanz: © Philipp Muigg
Bucherscheinung: Der Goldschakal – Lebenskünstler auf leisen Pfoten
Bucherscheinung: Der Goldschakal – Lebenskünstler auf leisen Pfoten
Ein Meilenstein für die Wissensvermittlung einer faszinierenden Art.
Bucherscheinung: Der Goldschakal – Lebenskünstler auf leisen Pfoten
Der Goldschakal (Canis aureus) breitet sich in Europa gegenwärtig auf natürlichem Wege aus. In Österreich sorgt die Art immer wieder für Aufsehen, etwa durch den ersten Nachweis in Wien 2023 und die abenteuerliche Reise eines besenderten Individuums bis in die Hohen Tauern, oder die heiß diskutierte Bejagung.
Seit 10 Jahren läuft am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft (IWJ) das von von Dr. Jennifer Hatlauf initiierte Goldschakalprojekt, in welchem bereits viel Grundlagenforschung geleistet wurde. Nun sind gesammelte Ergebnisse auch in Buchform erschienen (link zur Pressemeldung der BOKU) :
Das Buch „Der Goldschakal – Lebenskünstler auf leisen Pfoten“ist die bislang umfangreichste Monographie zu dieser Art weltweit. Die Publikation ist das erste deutschsprachige Werk zum Goldschakal und ist in zwei Bänden angelegt. Band 1 umfasst 264 Seiten und über 450 Abbildungen und deckt Themen ab wie Verbreitung, Lebensräume, Biologie, Nahrung, Verhalten, Fortpflanzung und Kommunikation. Das Werk verbindet Forschung und Praxis gezielt – es ist sowohl für Laien, Jäger*innen als auch Wissenschaftler*innen eine Fundgrube.
Das Buch ist direkt bei uns am Institut erhältlich, oder kann hier bestellt werden: www.aureus.co.at oder https://linkup.shop/aureus# (Smartphone link)
Die öffentliche Buchpräsentation findet unter Moderation von Univ.Prof.Dr. Klaus Hackländer am 5. November an der BOKU statt: https://boku.ac.at/event/details/86779
Rothirsche lieben es ruhig
Dies konnte IWJ-Doktorand Thomas Rempfler, Mitarbeiter im Schweizerischen Nationalpark, mit einer nun publizierten Studie bestätigen. Anhand von GPS-Daten von über 240 Tieren wurde verglichen, wie sich ihr Verhalten innerhalb von Jagdverbotszonen, im Schweizerischen Nationalpark und in ungeschützten Gebieten unterscheidet. Quintessenz: Rothirsche passen ihre Lebensraumnutzung stark an menschliche Präsenz und Jagddruck an. Netzwerke kleiner Schutzgebiete bieten ihnen dringend benötigte Rückzugsräume. Die Ergebnisse wurden nun gemeinsam mit Wibke Peters, Claudio Signer, Flurin Filli, Hannes Jenny, Sven Buchmann, Pia Anderwald und Klaus Hackländer im Fachjournal Ecology and Evolution publiziert.
Link: https://doi.org/10.1002/ece3.71407
Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer
BOKU University
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft
Department für Ökosystemmangement, Klima und Biodiversität
Neue Website für Schneesperlingsprojekt
Das von IWJ-Mitarbeiterin PD Dr. Sabine Hille geleitete Schneesperlingsprojekt hat eine neue Internetpräsenz. Unter https://www.alpine-biodiversity.at/ findet man alle Informationen über das laufende Projekt, links zu den Publikationen und Hinweise, wie man sich selbst in das Projekt einbringen kann - sei es im Rahmen von universitären Abschlussarbeiten, in Form von Citizen Science oder auch als Förderer.
Grober Keiler wandert weiter
Beim 37. Institutsschießen des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der BOKU erreichte Dr. Johann Blaimauer die höchste Punktzahl und erhielt somit den Wanderpokal Grober Keiler, gestiftet von Altrektor Univ.Prof. Dr. Martin Gerzabek. Blaimauer, u.a. Obmann des Niederwildfachausschusses im NÖ Jagdverband und Lehrender im Universitätslehrgang Jagdwirt*in, war insbesondere im Umgang mit dem Narkosegewehr einsame Spitze.
Der Sanfte Keiler, der Preis für die beste Schützin ging an Johanna Willner, Bachelorstudentin der Forstwirtschaft und Lehrforstjägerin. Astrid Pledermann BSc, technische Mitarbeiterin am IWJ, rettete für das Institut den Blinden Keiler. Insgesamt verlebten 23 Schütz*innen einen unterhaltsamen und gemütlichen Tag in der Schießstätte des NÖ Jagdverbandes in Merkenstein.
Unser Dank gilt dem Schießstättenleiter, Dipl.-HLFL-Ing. Rudolf Hafellner, Diana Pöttschacher und allen Standbetreuern für die perfekte Organisation.
Weiters bedanken wir uns herzlich bei unseren Sponsoren Der Anblick, Fair Hunt, Österreichische Bundesforste AG sowie Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag.
Steinböcken auf der Spur
In einer aktuellen Studie unter Beiteiligung des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft wurde analysiert, welche Faktoren das saisonale Wanderverhalten von 406 GPS-markierten Alpensteinböcken (Capra ibex) aus 17 Populationen in den Alpen beeinflussten. Die im Journal Movement Ecology erschienene Publikation zeigt, dass Im Frühjahr der Zeitpunkt der Aufwärtsmigration stark mit dem Beginn der Vegetationsperiode (Green-up) und der Schneeschmelze korrelierte. Ein späterer Vegetationsbeginn verzögerte die Migration durchschnittlich um 6,4 Tage bei Männchen und 2,7 Tage bei Weibchen. Auch längere Vegetationsperioden und spätere Schneeschmelze führten zu einem verzögerten Aufstieg. Im Herbst wiederum verschoben ein späterer Vegetationsverfall und verzögerter Schneefall die Rückkehr ins Tal. Insgesamt zeigten die Tiere eine ausgeprägte plastische Anpassung an jährliche Umweltveränderungen, allerdings ist diese Reaktion weniger stark als die Veränderungen in der Umwelt selbst. Weibchen reagierten im Frühjahr weniger flexibel als Männchen, was vermutlich mit reproduktiven Zwängen zusammenhängt. Die wichtigsten Einflussfaktoren auf das Migrationsverhalten waren die Vegetationsphänologie und Schneeverhältnisse, welche stark durch den Klimawandel beeinflusst werden. Die beobachtete geschlechtsabhängige Plastizität legt nahe, dass Männchen und Weibchen unterschiedlich gut auf zukünftige Umweltveränderungen reagieren könnten.
Die ganze Publikation findet sich hier:
https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1365-2656.70031
Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer
Institutsvorstand
BOKU University
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft
Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität
Felicitas Oehler promoviert
Heute hat Felicitas Oehler MSc vor der Prüfungskommission und zahlreichen Gästen ihre Dissertation zum Thema “Dispersal identification and characteristics of movement patterns of red foxes (Vulpes vulpes)” souverän präsentiert und mit Bravour verteidigt.
Wir gratulieren herzlich!
Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer
Institutsvorstand
Rising Temperatures Advance Start and End of the Breeding Season of an Alpine Bird
Carole A. Niffenegger | Sabine M. Hille | Christian Schano | Franzi Korner-Nievergelt
Infolge des wärmer werdenden Klimas verschieben viele Tierarten ihre Reproduktionszeiten. Viele Vogelarten verfrühen ihre Brutzeit. Die kälteangepassten hochalpinen Arten wie der Schneesperling reagieren nicht nur auf Temperatur, sondern auch auf die Schneelage und den Niederschlag. Trockene warme Frühjahrstemperaturen beeinflussen einen früheren Brutstart. Warme Temperaturen und Schneelage während der Aufzuchtszeit dagegen verkürzen die Brutzeit. Diese komplexen Wechselwirkungen zeigen wie die sich verändernde Brutbedingungen den Nachwuchs der Schneesperlinge beeinflussen. Eine Reaktion ist weiter nach oben zu wandern, hier sind aber Grenzen gesetzt.
In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Vogelwarte hat unsere Doktorandin (BOKU/Vogelwarte CH) diese Forschungsarbeit im Rahmen ihrer Dissertation publiziert.
https://doi.org/10.1002/ece3.70897
Stipendium der Salzburger Nationalparkverwaltung für Sarah Wagner
Die Masterstudentin Sarah Wagner erhielt für ihre laufende Masterarbeit im Studium Wildtierökologie und Wildtiermanagement ein Stipendium der Salzburger Nationalparkverwaltung. Im Rahmen ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit dem Einfluss der kleinräumigen Sichtbarkeit auf die Habitatwahl des Rothirsches. Konkret werden GPS-Daten von besenderten Rothirschen mit Vegetationsparametern (zur Bestimmung der kleinräumigen Sichtbarkeit) verschnitten um die Aufenthaltswahrscheinlichkeit sowie Aufenthaltsdauer von Rothirschen in bestimmten Habitaten vorherzusagen. Zusätzliche Faktoren wie die Tageszeit, Lufttemperatur sowie Witterung werden in die Modellierung inkludiert. Angesprochene Vegetationsparameter sollen mit Hilfe einer Kombination aus PLS (Personal Laser Scanning) und ALS (Airborne Laser Scanning) Daten bestimmt werden. Basierend auf PLS-Stichprobenpunkten wird zunächst die kleinräumige Sichtbarkeit berechnet und anschließend mit Metriken aus ALS Daten und einem statistischen Modell auf die gesamte Fläche des Untersuchungsgebiets (Nationalparkreviere im Habachtal, Obersulzbachtal und Untersulzbachtal) hochgerechnet. Wir dürfen gespannt sein auf die Ergebnisse dieser Arbeit!
Das Team des IWJ gratuliert herzlichst zu diesem Stipendium!
Wir trauern um Andreas Daim (1983-2025)
In großer Trauer nehmen wir Abschied von unserem ehemaligen Mitarbeiter, Kollegen und Freund Andreas Daim MSc, der am 1. Mai 2025 nach schwerer Krankheit im Alter von 41 Jahren zu früh von uns gegangen ist.
Andreas studierte zunächst an der TU Wien Medieninformatik und an der BOKU University die Bachelor- und Masterprogramme Holz- und Naturfasertechnologie. Später folgte er seiner Leidenschaft und absolvierte an der BOKU und der Vetmeduni Wien das Masterprogramm Wildtierökologie und Wildtiermanagement. Seine Masterarbeit führte ihn an die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, wo er am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung zum Schwarzwild forschte.
Während der akademischen Ausbildung zeichnete Andreas sich nicht nur als herausragender Student aus, sondern glänzte auch durch sein ehrenamtliches Engagement, z.B. als Studierendenvertreter in der Fachstudien-AG Forst, Holz, Naturgefahren & Wild, im Departmentkollegium des Departments für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung sowie in der Österreichischen Hochschülerschaft der BOKU (u.a. Doktoratsvertretung, EDV Administration, Bokuball-Team, Ökosoziales Studierenden Forum). In der Freizeit ging er nicht nur dem Weidwerk nach, sondern verschrieb sich auch der Imkerei. Auch hier bestach er durch Innovation und Engagement, war er doch als Jagdaufseher tätig und bot seine Honigkreationen u.a. auf dem BOKU-Bauernmarkt an.
Aktuell war Andreas im Rahmen des FFG-Projektes „Einflüsse der Jagd mit Nachtsichtzielgeräten und Schalldämpfern auf das Raum-Zeit-Verhalten bei Schwarzwild“ als Doktorand am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der BOKU tätig. Sein unermüdlicher Forschungsdrang, seine innovativen Ideen und sein Teamgeist wurde nicht nur an der BOKU, sondern auch beim Projektpartner, der Österreichischen Bundesforste AG (Nationalparkbetrieb Donauauen), und bei den internationalen wissenschaftlichen Netzwerken wie EuroBoar geschätzt. Seine Expertise brachte er auch als Mitarbeiter des Internationalen Rates zur Erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) ein, für den er das Rote Buch zur Bewertung von Jagdtrophäen überarbeitete. Neben seinem Doktorat baute er das Wildbüro Daim e.U. auf und stand damit vielen Praktikern mit seiner wissenschaftlichen Kompetenz zur Verfügung. Andreas engagierte sich auch in der Lehre, sei es an der BOKU im Masterprogramm Wildtierökologie und Wildtiermanagement und im Universitätslehrgang Jagdwirt*in oder in der Jungjägerausbildung des NÖ Jagdverbandes. Studierende und Lehrgangsteilnehmende schätzten gleichermaßen sein umfassendes Wissen über Wildbiologie und Jagd sowie seinen kollegialen Umgang.
Trotz seiner schweren Krankheit war Andreas stets zuversichtlich und optimistisch. Er ging seiner Arbeit unermüdlich nach und ließ nicht zu, dass sein Krankheitsverlauf den Takt vorgab. Damit gab er sich und uns Hoffnung, Trost und Kraft, auch über den Tod hinaus.
Wir trauern um einen geschätzten Kollegen, lieben Freund, verlässlichen Partner und ein großes Vorbild.
Junglehrenden-Anerkennungspreis für Fabian Knufinke
Jörg Fabian Knufinke, M.Sc.
Statement zur Lehre:
Die BOKU verfolgt die Vision, eine der führenden Nachhaltigkeitsuniversitäten Europas zu sein – nicht zuletzt durch exzellente und nachhaltige Lehre. Als Lehrender kann ich meinen Teil dazu beitragen, indem ich gemeinsam mit den Studierenden ein angenehmes und produktives Klima für das Lehren und Lernen schaffe. Diese positive Atmosphäre fördert den Austausch, steigert die Freude am Lernen und trägt zum Erfolg der Studierenden bei. Dank der aktuellen Diskussionsthemen und der Vielfalt der Studierenden mit ihren unterschiedlichen Hintergründen, Perspektiven und Denkweisen bleibt meine Lehre stets spannend. Dadurch erweitere auch ich kontinuierlich meinen eigenen Horizont.
Kommentar der Jury:
Die Jury erachtet den didaktischen Methodeneinsatz als besonders wertvoll, da er durch interaktive, inter- und transdisziplinäre Ansätze ganzheitliches Denken und praxisnahe Zukunftsperspektiven fördert.
Research Funding Award für Projekt von Florian Kunz
Grundlagen zur Wildtiervernetzung sind essentiell, um die Biodiversität zu verstehen und damit die nachhaltige Entwicklung zu fördern. Umso mehr, da die Landschafts- und Raumplanung Biodiversität auch mit Notwendigkeiten der Energieinfrastruktur abstimmen muss.
Mit dem Projekt "ConEn - Energiewende versus Wildtiervernetzung: Grundlagen für die nachhaltige Entwicklung" will Florian Kunz will hier wesentliche Grundlagen schaffen, wofür er kürzlich mit dem Research Funding Award der Jubiläumsfond der Stadt Wien für die BOKU ausgezeichnet wurde.
Wir gratulieren und wünschen dem Projekt viel Erfolg!
https://boku.ac.at/news/newsitem/83416
Mit Kamerafallen Wilddichten bestimmen
Entscheidungen im Wildtiermanagement erfordern eine genaue Kenntnis von Populationsparametern wie der Dichte. Für die Schätzung der Dichte von nicht-markierten Wildtieren können Kamerafallen zum Einsatz kommen, die Daten für die Berechnung des sogenannten Random Encounter Modellen (REM) liefern.
In einer nun in der Fachzeitschrift European Journal of Wildlife Research veröffentlichten Studie von Stephanie Wohlfahrt et al. wird die Genauigkeit des REM in kleinen Gebieten unter Berücksichtigung der Größe und Form des Untersuchungsgebiets sowie des Aggregationsverhaltens der Arten bewertet.
Kamerafallendaten aus 19 alpinen und kontinentalen Gebieten in Österreich, die 28 Huftierpopulationen von Rehwild, Rothirsch, Gämse und Wildschwein beherbergen, wurden analysiert. Die Studie belegt eindrucksvoll, dass für das Wildtiermanagement Kamerafallen und die Verwendung von REM sehr gut für Dichtschätzungen von Wildtieren geeinget sind.
Link zur Studie:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-025-01913-8
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft
Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer
Vorstand
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)
Department für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität
Wildökologisches Forum Alpenraum 2025
Lebensräume für Menschen und Wildtiere im Wandel.
Unter diesem Motto steht das Wildökologische Forum Alpenraum 2025.
Anmeldung ab sofort möglich.
Einladung (zum Download - PDF)
Biber sind nicht immer treu
Zwar sind viele Säugetierarten monogam, dennoch suchen sie auch Paarungen außerhalb ihrer eigentlichen Partnerschaft. Marcia Sittenthaler und Kolleg*innen von Naturhistorischen Museum Wien und der BOKU University wiesen dies nun auch für den Biber in Niederösterreich nach, wenn auch in einem recht geringen Ausmaß: zwei von 42 Würfen (4,8%) wurden von zwei verschiedenen Männchen gezeugt. Die Studie ist in der renommierten Fachzeitschrift Mammalian Biology erschienen.
https://link.springer.com/article/10.1007/s42991-024-00450-2
Foto: Per Harald Olsen/Wikipedia
Forschungsprojekt zu Schneesperlingen im Klimawandel
Arte/Bayern 3 Film: Heißzeit, bedrohte Natur in den Alpen
Im Sommer 2024 begleitete ein Kamerateam die Forscher:innen unseres Instituts auf 2400m üNN auf der Großglockner Höhenstrasse. Unterwegs auf Schneefeldern, bei Wind und Wetter folgten sie unserer Arbeit direkt bei und mit den Hochgebirgsvögeln, den Schneesperlingen. Der Beitrag ist nun neben anderen Fachbeitragen über bedrohte Arten im Hochgebirge im Arte Film „Heißzeit, bedrohte Natur in den Alpen“ zu sehen. Der Film beschreibt welche Probleme sich durch die starke Erwärmung der alpinen Lebensräume für verschiedene Arten ergeben.
Video-on-Demand und Website zur Sendung:
https://www.arte.tv/de/videos/117700-000-A/heisszeit/
ARTE: TV-Ausstrahlung am Freitag, 28. Februar um 17:50 mehrsprachig mit Untertiteln
Rising Temperatures Advance Start and End of the Breeding Season of an Alpine Bird
Ecology & Evolution
Viele Vogelarten haben als Reaktion auf den Klimawandel den Beginn der Brutsaison vorverlegt. Die Dauer der Brutsaison und ihre Auswirkungen auf den Klimawandel sind weitaus weniger erforscht, sind jedoch für den gesamten Reproduktionserfolg inklusive Zweitbruten von Bedeutung. Hier haben wir untersucht, wie Temperatur, Niederschlag und Schneebedingungen den Beginn, das Ende und die Dauer der Brutsaison des Kälte angepassten Schneesperlings der Hochalpen beeinflussen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass höhere Temperaturen vor der Brutzeit und geringere Niederschläge im April mit einem früheren Brutbeginn verbunden waren. Später in der Brutzeit verkürzten höhere Temperaturen jedoch die Brutzeit bis hin zu einem früheren Ende der Brutzeit. Trotz Anpassung des Brutbeginns an die vorherrschenden Umweltbedingungen stiegen die Durchschnittstemperaturen während der Brutzeit während des 16-jährigen Untersuchungszeitraums. Daher müssen Schneefinken in höhere Lagen ziehen, um die thermischen Bedingungen zu verfolgen. Diese Studie hebt die komplexe Beziehung zwischen Phänologie und Umweltbedingungen hervor und veranschaulicht, wie stark sich die Brutbedingungen für hochalpine Arten derzeit ändern.
DOI: 10.1002/ece3.70897
Museomics help resolving the phylogeny of snowfinches (Aves, Passeridae, Montifringilla and allies)
Molecular Phylogenetics and Evolution
DNA aus Museumsbälgen zu extrahieren und Phylogenien zu erstellen gelang am Beispiel der Gruppe der Schneesperlinge. In dieser Studie konnte unter vielem anderen gezeigt werden, dass die weltweit vertretenen Schneesperlinge Montifringilla und Pyrgilauda reziprok monophyletisch sind und, dass die europäischen und asiatischen Abstammungslinien des Schneesperlings Montifringilla sich vor ca. 2 Mio. Jahren entwickelten. Die europäische Art Montifringilla nivalis Linie geht aus den Schneesperlingsgruppe des tibetischen Hochlandes hervor.
https://doi.org/10.1016/j.ympev.2024.108135
Die Rückkehr der großen Pflanzenfresser
Große Pflanzenfresser sind in Mitteleuropa weitgehend ausgestorben, geraten aber zunehmend wieder in den Fokus von Öffentlichkeit und Fachwelt. Das liegt sowohl an der natürlichen Rückkehr von Wisent, Elch & Co. - aber auch an der steigenden Anzahl von Naturschutzprojekten, in denen große Pflanzenfresser als Lebensraumgestalter eingesetzt werden. Wie stark haben große Pflanzenfresser unsere Lebensräume vor deren Kultivierung durch den Menschen tatsächlich geprägt? Gibt es in Mitteleuropa überhaupt genügend Platz für frei lebende große Pflanzenfresser? Wie könnte ein Nebeneinander von Mensch, Wisent und Co. funktionieren?
Dr. Sebastian Brackhane und Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer stellen in ihrem neuen Buch gemeinsam mit 40 weiteren Autor*innen die »großen Fünf« - Elch, Wisent, Rothirsch, Pferd, Rind - vor, führen ein in Grundlagen des Wildtiermanagements und diskutieren Beweidungsprojekte im Naturschutz und neue Konzepte wie das Rewilding. Das Buch möchte Wege aufzeigen, die ein Zusammenleben von großen Pflanzenfressern und Menschen in Mitteleuropa ermöglichen. Es richtet sich sowohl an Wissenschaftler, Naturschutzpraktiker als auch an interessierte Laien.
Zahlreiche Illustrationen, Karten und Fotos veranschaulichen den Inhalt.
Ab 6.2. im Handel
Link:
https://www.oekom.de/buch/die-rueckkehr-der-grossen-pflanzenfresser-9783987260315
Bedeutung von Nagern für Buchensamenverbreitung
Nagetiere fungieren sowohl als Räuber als auch als Verbreiter von Pflanzensamen. Empirische Daten über das gesamte Schicksal der Samen bis zur Keimung und den Einfluss von Nagetieren auf das Überleben der Samen sind rar. In einer nun im Jounal Biology Letters erschienenen Studie haben Fredrik Sachser MSc und Assoc.Prof. Dr. Ursula Nopp-Mayr vom IWJ sowie Univ.Prof. Dr. Georg Gratzer von der Waldkökologie gemeinsam mit weiteren Kolleg*innen den jährlichen Samenregen und die Häufigkeit von Nagetieren in einem alten europäischen Buchenwald quantifiziert und 639 Bucheckern bis zum Keimlingsstadium verfolgt, wobei 84 % der Samen erfolgreich gefunden wurden. In vier Untersuchungsjahren, die das gesamte Spektrum des Verhältnisses von Samen zu Nagetieren abdeckten, keimte kein einziger Samen nach der Ausbreitung erfolgreich, was auf eine überwiegend antagonistische Interaktion zwischen Nagetieren und Samen der Rotbuche hinweist. Die Ergebnisse stützen daher nicht die Hypothese der Ausbreitung durch Nagetiere .
Link: https://doi.org/10.1098/rsbl.2024.0586
Foto: Gerhard Elsner/wikicommons
Erneuerbare Energien und Wildtiere
-

Foto credit: Michael Tetzlaff/Deutsche Wildtier Stiftung
In dieser Woche läuft wieder "Vom Leben der Natur" auf Radio Ö1 mit Klaus Hackländer, Leiter des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft. Er berichtet über die Auswirkungen der Energiewende auf Wildtiere: Wasserkraft, Windkraft, Biomasse und Sonnenenergie können Wildtiere gefährden, aber es gibt auch Lösungen zur Abschwächung negativer Wirkungen.
Link:
https://oe1.orf.at/programm/20250120/782432/Erneuerbare-Energien-und-Artenschutz-1
Foto credit: Michael Tetzlaff/Deutsche Wildtier Stiftung
Wenn sich junge Rotfüchse auf Wanderschaft begeben
-

Copyright Deutsche Wildtier Stiftung
Im Rahmen ihrer Doktorarbeit am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der BOKU widmet sich Felicitas Oehler dem Abwanderungsverhalten von Rotfüchsen. Dabei konnte sie feststellen, dass sich junge Füchse, die ihr Geburtsgebiet verlassen und auf die Suche nach einem eigenen Territorium gehen, sehr flexibel agieren. Die Bewegungsmuster von Rotfüchsen unterscheiden sich zwischen vorübergehenden, erkundenden und stationären Phasen. Diese spiegeln Strategien der Fortbewegung, der Suche und des Aufenthalts wider. Eine hohe Bewegungsvariabilität könnte es Rotfüchsen ermöglichen, sich effizient in exterritorialen Gebieten zu bewegen und sich an unterschiedliche Umwelt- und Verhaltensbedingungen anzupassen. Erste Ergebnisse sind nun im Journal Movement Ecology erschienen.
Link: https://doi.org/10.1186/s40462-024-00526-1
Nahrungsökologie des Rotwildes
Thomas Rempfler, Mitarbeiter des Schweizerischen Nationalparks, erforscht in seiner Dissertation am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft unter der Betreuung von Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer die Habitatnutzung besenderter Rothirsche. In seiner aktuellen Publikation im Journal Movement Ecology berichtet er mit seinem Team über die Nahrungswahl des Wiederkäuers. Rothirsche wählen in Sommerlebensräumen eher die Quantität als die Qualität des Futters, wobei es kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Die Weibchen reagieren stärker auf menschliche Aktivitäten und bevorzugen daher den Schweizerischen Nationalpark. Die Ergebnisse zeigen die Möglichkeiten, mit Hilfe von Satellitendaten die Futterqualität und -quantität für Studien zur Bewegungsökologie getrennt zu schätzen.
Link: https://doi.org/10.1186/s40462-024-00521-6
Einblick in das soziale Verhalten von Goldschakalen auf Samos, Greichenland
Bisher nicht für möglich gehalten wurde nun in einer Studie die individuelle Unterscheidung von Goldschakalen erstmals dokumentiert. Dies wiederum galt als Basis für weitere Untersuchungen um die bemerkenswerte Verhaltensflexibilität von Goldschakalen zu studieren. Trotz deren weiten Verbreitung in Europa ist das Sozialverhalten dieser Art noch wenig erforscht. In einer neunmonatigen Studie auf der griechischen Insel Samos untersuchte ein Forscherteam mit Unterstützung der Organisation Archipelagos anhand von Kamerafallen eine Schakal-Familiengruppe sehr genau. Dr. Jennifer Hatlauf, vom Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft unterstütze diese Bemühungen und nun wurde die Studie in dem hoch gereihten Journal “Ecology and Evolution” publiziert. Diese Ausgabe des Journals ziert sogar ein Bild der Forschungsgruppe (LINK zum COVER: https://onlinelibrary.wiley.com/cover/20457758)
Durch individuelle Identifikation und soziale Netzwerkanalysen konnten die stabile Struktur der untersuchten Goldschakalgruppe aufgedeckt werden: ein dominantes Paar mit Nachwuchs aus ein bis zwei Generationen. Während der Fortpflanzungszeit wurden deutliche Veränderungen beobachtet, darunter die Geburt von sechs Welpen, die von beiden Elternteilen UND helfenden Jungtieren versorgt wurden. Die Ergebnisse lieferten neue Erkenntnisse zur sozialen Organisation dieser einzigartigen Art. Auch Vergleichsbilder und Videos sind über die Publikation anzusehen.
Custers J, Hatlauf J, van der Niet S, Tintoré B, Miliou A (2024), The Secret Family Life of a Group of Golden Jackals on Samos, Greece. Ecol Evol, 14: e70620. https://doi.org/10.1002/ece3.70620
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ece3.70620
Schutzstatus von Wölfen in Europa – kommt bald die Wolfsjagd in Österreich?
Die Absicht der EU, den Schutzstatus des Wolfes in der Berner Konvention zu ändern, brachte ordentlich Bewegung in die hitzigen Debatten um den Umgang mit dem Wolf in Österreich. Die einen fürchten die Wiederausrottung, während die anderen eine langersehnte Bejagung auf den Wolf erwarten. Doch was ist nun wirklich Sache?
Dr. Jennifer Hatlauf und Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer haben dazu Stellung bezogen
Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft
Univ.Prof. Dr. Klaus Hackländer
Vorstand
Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)
Department für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung
Schutzstatus von Wölfen in Europa (Download - PDF)
157. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft
Die 157. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft e.V. (DOG) wurde gemeinsam mit dem Naturhistorischen Museum Wien (NHM) ausgerichtet und fand an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) vom 18. bis 22. September 2024 statt. Unterstützt wurden BOKU und NHM bei der Durchführung der Tagung von BirdLife Österreich, der Konrad Lorenz Forschungsstelle Grünau (Universität Wien) und der Österreichische Vogelwarte (Veterinärmedizinische Universität Wien).
Trotz der teilweise erschwerten Anreise aufgrund der Hochwasserlage im Osten Österreichs konnten die Teilnehmer*innen bei der Eröffnungsveranstaltung am 19. September 2024 vom Präsidenten der DOG Wolfgang Fiedler begrüßt werden. Weitere Grußworte kamen von der BOKU-Rektorin Eva Schulev-Steindl und NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland.
Während der Tagung mit Schwerpunktthemen in den Bereichen Aviäre Malaria und Parasiten, Vogelschutz und Landnutzung, Alpenraum und Vogelzug, und Raumnutzung und Vernetzung wurde der aktuelle Stand der Wissenschaft vermittelt und es bestand die Möglichkeit, sich mit anderen Ornitholog*innen und Wissenschaftler*innen auszutauschen. Darüber hinaus gab es neben freien Themen auch Symposien zu den Themen Vogelschlag an Gebäuden, Soziale Aspekte von Vogelarten und Vogelbeobachtung, Steinadler: LifeTrack Golden Eagle, und Vogelschutz in Österreich. Ein krönender Abschluss für die knapp 300 Teilnehmer*innen der Tagung war der Gesellschaftsabend in der Kuppelhalle des NHM, bei welchem die Preisverleihungen stattfanden.
Das Programm wurde durch Exkursionen an den Neusiedler See, auf die Raxalpe, in die Lobau und zur Konrad Lorenz Forschungsstelle nach Grünau im Almtal abgerundet, die Einblicke in die unterschiedlichen Naturräume Österreichs und deren Vogelwelt gaben.
Foto: © Nathalie Kürten
Paul Griesberger beendet sein Doktorat mit Auszeichnung
Am 30.8. 2024 verteidigte Paul Griesberger erfolgreich seine Dissertation zum Thema "Management von wiederkäuenden Schalenwildarten in Österreich: Herausforderungen und Lösungswege". Die Ergebnisse dieser Dissertation sind als Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis zu verstehen und sollen dazu beitragen, das Schalenwildmanagement an bestehende sowie zukünftige Herausforderungen anzupassen.
Paul Griesberger tritt künftig die Nachfolge von Univ.Ass. Dr. Fredy Frey-Roos an, der Ende Juni in den Ruhestand verabschiedet wurde.
Das IWJ gratuliert Paul Griesberger zu beiden Karriereschritten herzlich!
Artikel zur Koexistenz von Alpenschneehasen und Feldhasen in den Alpen!
In den Alpen kommen Alpenschneehasen und Feldhasen parapatrisch entlang des Höhengradienten vor und hybridisieren in sich überschneidenden Gebieten miteinander. In dieser Studie untersuchten wir die Nahrungsökologie von Alpenschneehasen, Feldhasen und ihren Hybriden in den Alpen, indem wir Hasenkot entlang des Höhengradienten in Graubünden (Schweiz) sammelten. Die pflanzlichen Bestandteile im Kot von 49 Feldhasen, 16 Alpenschneehasen und 22 Hybriden wurden auf der Ebene der Dikotyledonen/Monokotyledonen, der Pflanzenfamilie und der Pflanzenarten identifiziert. Alpenschneehasen nutzten signifikant mehr Ericaceae als Nahrungspflanzen als Feldhasen und Hybriden. Da Schneehasen Phenole in der Nahrung besser vertragen als Feldhasen, deuten unsere Ergebnisse darauf hin, dass die Ernährung der beiden Lagomorphenarten vom Phenolgehalt im alpinen Ökosystem beeinflusst wird.
„Silent Cities“ - Neue Publikation mit Beteiligung des IWJ
Wien, 03.09.2024
Politische Reaktionen auf die COVID-19-Pandemie führten zu Veränderungen in der Geräuschkulisse von Städten rund um den Globus. Von März bis Oktober 2020 erstellte ein Konsortium von 261 Mitwirkenden aus 35 Ländern im Rahmen des Silent-Cities-Projekts eine einzigartige Sammlung von Geräuschaufnahmen. Das Ziel dieser Erhebung bestand darin, einen Datensatz zu generieren, welcher es ermöglicht Einflüsse menschlicher Geräusche auf die Biophonie (Geräusche der Natur, z.B. Vogelgesang) untersuchen zu können. Im Rahmen einer Publikation, mit Beteiligung des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, wurde dieser Datensatz nun aufbereitet und veröffentlicht, um ihn für verschiedenste Analysen zur Verfügung zu stellen. Konkret inkludiert dieser Datensatz die aufbereiteten Geräuschaufnahmen, zugehörige Metadaten, Beschreibungen der lokalen Untersuchungsgebiete sowie Open-Source-Umweltdaten.
Weiterführende Informationen zu diesem Projekt sowie Datensatz finden sich in der angesprochenen Publikation:
Challéat, S., Farrugia, N., Froidevaux, J.S.P. et al. A dataset of acoustic measurements from soundscapes collected worldwide during the COVID-19 pandemic. Sci Data 11, 928 (2024). https://doi.org/10.1038/s41597-024-03611-7
Wissenschaftliche Kontakte am IWJ: Paul Griesberger (paul.griesberger(at)boku.ac.at) und Jennifer Hatlauf (jennifer.hatlauf(at)boku.ac.at)
15 Jahre Universitätslehrgang Jagdwirt*in und Abschied Univ.Ass. Dr. Fredy Frey-Roos
Der Universitätslehrgang hat sich seit seinem Start vor 15 Jahren nicht nur als innovatives akademisches Weiterbildungsformat in der deutschsprachigen Jagdszene etabliert, auch als gewaltiges Netzwerk unter Gleichgesinnten sind die Signale nicht mehr zu überhören. Dies wurde Mitte Juni zum Anlass für einen gelungenen Festakt mit anschließender "Wilden Grillerei" im Innenhof unserer Universität genommen. Mehr als 120 Gäste aus dem In- und Ausland feierten mit uns.
Die Feierstunde wurde auch dazu genutzt, um Univ. Ass. Dr. Fredy Frey-Roos gebührend in den wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden.
Frey-Roos war seit 2005 am IWJ in Forschung und Lehre tätig. Sein Hauptengagement gehörte der Lebensraumvernetzung, die er unter anderem mit der Etablierung des Alpen-Karpaten-Korridors für weitwandernde Wildtiere umsetzte. Für sein Wirken als Lehrender und stv. Leiter im Universitätslehrgang wurde er mit der goldenen Jagdwirt-Ehrennadel ausgezeichnet.
Wir grautlieren herzlich!
https://jagdwirt.at/Article/id/1121/horrido-15-jahre-akademische-jagdwirtinnen

TAG 1: EXKURSION - Allentsteig Truppenübungsplatz, NÖ
15. November 2024 07:30-20:00
Treffpunkt 07:30 BOKU, Gregor-Mendel-Straße 33
(Abfahrt 08:00)
TAG 2: Wildtierökologie Tagung - Festsaal BOKU Wien
16. November 2024 10:00-17:00
AGENDA folgt
Beginn: 10:00
Impulsvorträge
Mittagspause 12:30 - 13:30
Festreden
Ende 17:00
Ab 18:00 Gemeinsames Abendessen (Heuriger Fuhrgasslhuber)
AUFRUF! Bitte mit Vortragsthemen für die Tagung anmelden!
An alle Absolvent*innen: Bei Interesse einen Impulsvortrag zu halten bitte schreiben. Anmeldungen für die Veranstaltung bis 30.09.2024: jennifer.hatlauf(at)boku.ac.at
Die Lange Nacht der Forschung 2024
Auch in diesem Jahr war das Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft wieder auf der Langen Nacht der Forschung mit einem Stand vertreten. Mit dem Titel „Unseren Wildtieren auf der Spur – wer geht hier spazieren?“ lag der Fokus diesmal vor allem darauf den Besucherinnen und Besuchern einen Bezug zu den heimischen Wildtieren zu geben, mit denen sie „Tür an Tür“ leben. Präparate von Fuchs über Fischotter bis hin zu Hamster, Hirsch und Schneehuhn waren dabei die visuelle Unterstützung, um einen hautnahen Eindruck der Tiere zu vermitteln. Darüber hinaus wurde sich der Frage gewidmet, was Wildtierökologie ist und wieso diese so wichtig ist in Kombination mit Wildtiermanagement und warum diese Themen immer relevanter werden, wenn man die Artenvielfalt in unserem gemeinsamen Lebensraum erhalten will. Uns freut es immer wie interessiert und begeisterungsfähig die Besucherinnen und Besucher für das Thema Wildtiere und Artenschutz sind und wir bedanken uns für die rege Beteiligung!"
IWJ vertreten durch: Sophie Nöbauer, Jörg Fabian Knufinke, Matthias Amon und Max Bodanowitz
Jennifer Hatlauf ausgezeichnet
Goldschakal-Forscherin hat für ihre Dissertation den renommierten Gergely-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erhalten.
Dr. Jennifer Hatlauf hat den renommierten Stefan M. Gergely-Preis erhalten, welcher von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vergeben wird. Der mit 36.000 Euro dotierte Preis würdigt hervorragende Dissertationen zu Forschungsfragen in den Bereichen Umwelt-, Natur- und Artenschutz mit Bezug zu Österreich. Jennifer Hatlauf erhielt die Auszeichnung für ihre Dissertation am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft (IWJ) über den Goldschakal in Österreich und angrenzenden Regionen. Ihre Arbeit bietet wertvolle Einblicke in die Verbreitung und die Erforschung des Goldschakals, was zu einem besseren Verständnis der heimischen Tierwelt beiträgt und Grundlagen für weitere Erkenntnisse schafft. Bei Ihrer Rede wies Hatlauf auf die ansteigende Relevanz der Erforschung des sich ausbreitenden Goldschakals hin und dankte den Institutskolleg*innen und ihrem Doktorvater Univ. Prof. Klaus Hackländer für die langjährige Unterstützung.
(C) ÖAW/Daniel Hinterramskogler
NEW PAPER!
Building a decision-support tool to inform sustainability approaches under complexity: case study on managing wild ruminants
In wildlife management, differing perspectives among stakeholders generate conflicts about how to achieve disparate sustainability goals that include ecological, economic, and socio-cultural dimensions. To mitigate such conflicts, decisions regarding wildlife management must be taken thoughtfully. To our knowledge, there exists no integrative modeling framework to inform these decisions, considering all dimensions of sustainability. We constructed a decision-support tool based on stakeholder workshops and a Bayesian decision network to inform management of wild ruminants in the federal state of Lower Austria. We use collaborative decision analysis to compare resource allocations while accounting for tradeoffs among dimensions of sustainability. The tool is designed for application by non-technical users across diverse decision-making contexts with particular sets of wildlife management actions, objectives, and uncertainties. Our tool represents an important step toward developing and evaluating a transparent and replicable approach for mitigating wildlife-based conflicts in Europe and beyond.
Link to publication: Griesberger, P., Kunz, F., Hackländer, K. et al. Building a decision-support tool to inform sustainability approaches under complexity: Case study on managing wild ruminants. Ambio (2024). https://doi.org/10.1007/s13280-024-02020-9
Scientific Contact: Paul Griesberger (paul.griesberger(at)boku.ac.at), Florian Kunz (florian.kunz(at)boku.ac.at), Klaus Hackländer (klaus.hacklaender(at)boku.ac.at), Brady Mattsson (brady.mattsson(at)boku.ac.at)
Publikation des IWJ hat es im Journal WILDLIFE BIOLOGY unter die TOP 10 % geschafft
Gemessen anhand der Downloads aller Publikationen im Journal WILDLIFE BIOLOGY, hat es eine Publikation des IWJ im Jahr 2022 unter die TOP 10 % geschafft!
Link zur Publikation: Griesberger, P., Obermair, L., Zandl, J., Stalder, G., Arnold, W. & Hackländer K. (2022). Hunting suitability model: a new tool for managing wild ungulates. Wildlife Biology, 1–11. https://doi.org/10.1002/wlb3.01021
Wissenschaftliche Kontakte (BOKU): Paul Griesberger (paul.griesberger(at)boku.ac.at), Klaus Hackländer (klaus.hacklaender(at)boku.ac.at)
Vortrag Jobkompass Wildtierökologie
Die ALUMNI-Fachgruppe Wildtierökologie veranstaltet am 19. März 2024 einen Vortrag für den Jobkompass Wildtierökologie, alle Interessierten sind willkommen!
Benjamin Knes, MSc., Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Selbständiger Ornithologe im NP Neusiedler See - Seewinkel gibt in seinem Vortrag einen Einblick in die laufenden Projekte und die Arbeit in der Forschungsabteilung im Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel.
Dienstag, 19. März 2024, 18:00 Uhr, Gregor-Mendel-Haus, SR 13 / MENH
[ehem. HS II], Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien
Wie hängen Informationskampagnen und Meinungsbildung zu Wildtieren zusammen?
Wien, 4. März 2024
Diese Frage stellte sich eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe um die Felicitas Oehler, Doktorandin am Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft an der BOKU Wien. In einer Umfrage mit einer repräsentativen Stichprobe der deutschen Bevölkerung beantworteten die Teilnehmer in zwei aufeinander folgenden Jahren Fragen über Füchse.
Vor der zweiten Befragung wurden verschiedene Versionen eines Faltblatts über Füchse an 2448 Teilnehmer verteilt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmer mit zunehmendem Alter und höherem Bildungsniveau das
Merkblatt mit größerer Wahrscheinlichkeit lasen. Die Lesewahrscheinlichkeit stieg auch mit der Einstellung gegenüber Füchsen.
Teilnehmer, die das Faltblatt vollständig lasen, erwarben mehr Wissen über Füchse als diejenigen, die es nur teilweise lasen. Fotos trugen ebenfalls zu einem höheren Wissenszuwachs bei, schematische Darstellungen hingegen nicht. Außerdem erwarben die Teilnehmer, die eine Faktenliste lasen, im Vergleich zur Kontrollbedingung mehr Wissen.
Darüber hinaus wirkte sich die Kombination von visuellen und textlichen Merkmalen auf die Einstellung gegenüber Füchsen aus. Die Studie wurde nun in der Fachzeitschrift Conservation Science and Practice veröffentlicht.
Link zur Publikation:
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/csp2.13089
Mehr zum Fuchs: https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/fuchs
Akademische Feier Jagdwirt/in XIV. Jahrgang und GRANSER – United Global Academy Forschungspreise für eine Nachhaltige Jagd
-
 2 Bilder
2 BilderVordere Reihe v.l.n.r.: Christine Thurner, Julia Gerzer, Chris Schwenk, Elisabeth Bernecker, Falk Röhner, Claudia Weidenbusch, Rektorin Eva Schulev-Steindl Hintere Reihe v.l.n.r.: Klaus Hackländer, Maik Mokos, Uwe Reinhold, Hubert Salvenmoser, Andreas Schranzhofer, Maximilian Scharnagl, Robert Hess, Knut Nolte, Michael Ohlhoff, Peter Venuleth, Sebastian Schmid, Peter Windbichler, Bernhard Neunteufel, Fredy Frey-Roos, Philipp Kopetzky, Raul Schade -
 2 Bilder
2 Bilderv.l.n.r.: Paul Griesberger MSc., Dr. Stéphanie Schai-Braun, Prof. Dr.h.c. Günther A. Granser
Wien, 15. Dezember 2023
Die nächsten 20 Akademische Jagdwirt*innen als Botschafter*innen für eine nachhaltige Wildbewirtschaftung sind da!
„Wenn aus dem Gedanken „Akademischer Jagdwirt“ zu werden ein Lebensziel entsteht, dann weiß man als Absolvent bei so einer würdigen Feier an der BOKU Wien, dass man einen weiteren großen Schritt im Leben erreicht hat“, so der Jahrgangssprecher Philipp Kopetzky bei seiner emotionalen Dankesrede im Rahmen der Akademischen Feier des XIV. Jahrgangs des Universitätslehrgang Jagdwirt/in am Freitag, dem 15. Dezember 2023. Er und seine 19 Kommiliton*innen haben den Lehrgang erfolgreich absolviert. Mehr als 1.000 Stunden hochqualifizierter Vorträge, Übungen und Exkursionen aus über 60 Detailthemen haben den Absolvent*innen nicht nur die Jagd als Auftrag für die Vision „Schutz durch Nutzung“, sondern auch Österreich in all seinen Facetten gezeigt:
Ebenso ausgezeichnet wurden ihm Rahmen dieser Akademischen Feier die diesjährigen Preisträger des GRANSER – United Global Academy Forschungspreises für eine Nachhaltige Jagd, Dr. Stéphanie Schai-Braun und Paul Griesberger MSc.