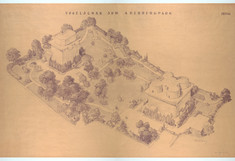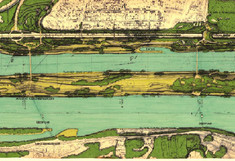Institutsprofil
Die Landschaftsarchitektur entwickelt, analysiert und gestaltet Freiräume und Landschaften. Ihre enge Verknüpfung mit den natürlichen Gegebenheiten – Topografie, Vegetation, Ökologie bis hin zu den klimatischen Bedingungen – macht die Landschaftsarchitektur zu einer Disziplin, die die notwendige Transformation der anthropogenen und anthropomorphen Lebensräume in Richtung Klimaverträglichkeit und Biodiversität vorantreibt. Am ILA verstehen wir Landschaftsarchitektur als Feld kultureller Produktion und stellen uns den grundlegenden sozialen und gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Konzeptionelle und gestalterische Antworten auf diese Fragen werden im Team erforscht und in Real-Life-Settings gelehrt.
Wir bauen auf die Erfahrungen und Errungenschaften der Vergangenheit auf und entwickeln zeitgemäße und zukunftsfähige Lösungen.
Wir arbeiten an diesen komplexen Aufgaben in internationalen Kooperationen mit Interessensvertretungen, Fachleuten aus der Praxis der Landschaftsarchitektur, aus verwandten Disziplinen und aus der Verwaltung.