Leitfaden für Masterarbeiten
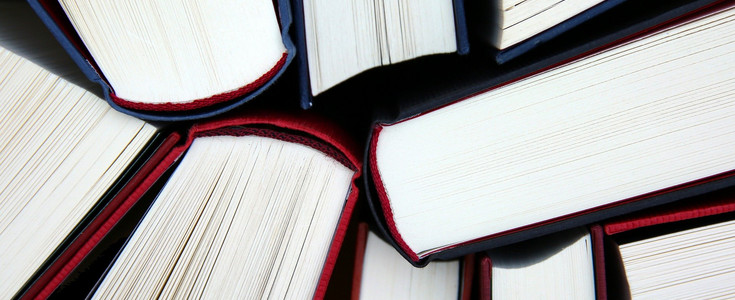
Leitfaden für Masterarbeiten
Arbeitsgruppe Agrar-, Umwelt- und Regionalökonomie, Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung
Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, Ihren Arbeitsprozess zu strukturieren und Ihre Masterarbeit gemäß wissenschaftlicher Standards und innerhalb einer annehmbaren Zeit fertigzustellen. Wir erläutern in diesem Leitfaden unsere Erwartungen an Sie und geben hilfreiche Empfehlungen zum Ablauf.
1. Grundlegendes: Was ist das Ziel einer Masterarbeit?
Gemäß nationalem Qualifikationsrahmen sollen Personen mit einem Masterabschluss folgende Fähigkeiten besitzen:
- Wissen und Verstehen demonstriert haben, … das eine Basis oder Möglichkeit liefert für Originalität im Entwickeln und/oder Anwenden von Ideen, häufig in einem Forschungskontext;
- ihr Wissen und Verstehen und ihre Problemlösungsfähigkeiten in neuen oder unvertrauten Zusammenhängen ... in ihrem Studienfach anwenden können;
- die Fähigkeit besitzen, Wissen zu integrieren und mit Komplexität umzugehen …;
- ihre Schlussfolgerungen und das Wissen und die Prinzipien, die ihnen zugrunde liegen, klar und eindeutig kommunizieren können, sowohl an Experten wie auch an Laien;
- über Lernstrategien verfügen, die es ihnen ermöglichen, ihre Studien größtenteils selbstbestimmt und autonom fortzusetzen.
Die Erreichung dieser Ziele sollen Sie (auch) mit Ihrer Masterarbeit zeigen. Das bedeutet, dass Sie sich in Ihrer Masterarbeit einer Forschungsfrage widmen sollen, die relevant ist und noch nicht ausreichend beantwortet wurde. Dabei sollen Sie sich an bereits bestehender Forschung orientieren. Eine Masterarbeit kann interessante und relevante Ergebnisse liefern, aber es ist wichtig, eine genau definierte Forschungsfrage zu haben und nicht zu versuchen, in einer Masterarbeit “alle Probleme dieser Welt zu lösen”, denn Forschung findet meist in vielen kleinen Schritten und Erweiterungen statt.
Ihre Forschungsfrage sollen Sie möglichst eigenständig bearbeiten und den Arbeitsprozess eigenständig strukturieren. Wir begleiten Sie dabei und geben Hilfestellung, gehen aber davon aus, dass Sie sich die optimale Herangehensweise an den Arbeitsprozess, die nötigen Methoden, wissenschaftliches Arbeiten allgemein, etc. selbstständig aneignen oder sich bereits angeeignet haben.
2. Welche Themen passen zu unserer Arbeitsgruppe?
Entsprechend den Forschungsbereichen der Mitglieder der Arbeitsgruppe Agrar-, Umwelt- und Regionalökonomie betreuen wir Masterarbeiten in den folgenden Bereichen:
- Agrarökonomik im weitesten Sinn (Fragen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Lebensmitteln)
- Umweltökonomik (insbesondere auch Umweltfragen im Bereich der Landwirtschaft und Landnutzung)
- Agrarsoziologie (insbesondere Fragen zum umweltrelevanten Verhalten von Landwirt*innen und zu Eigentumsverhältnissen)
- Regionalökonomie
- Ökonomie urbaner Räume
- Effizienz- und Produktivitätsanalysen sowie Analysen zu Konvergenz von Wirtschafts- (z.B. BIP/Kopf) und Umweltindikatoren (z.B. THG-Emissionsintensität) auf nationaler, regionaler oder betrieblicher Ebene
- Volkswirtschaftslehre im Allgemeinen
Auf unserer Website sowie auf der Abschlussarbeitenbörse der BOKU sind mitunter entsprechende Themen ausgeschrieben. Auch in den von unserer Arbeitsgruppe angebotenen Lehrveranstaltungen finden Sie Anregungen für interessante Fragestellungen. Sie können aber auch mit eigenen Ideen aus den oben genannten Bereichen an uns herantreten. Gerne können Sie Mitglieder der Arbeitsgruppe im Zuge von Lehrveranstaltungen nach möglichen Themen für Masterarbeiten fragen.
Wichtig: Sie sollten bereits über Grundlagenwissen in dem Themenbereich verfügen, mit dem Sie sich beschäftigen möchten; dies betrifft insbesondere auch die möglichen Methoden (z.B. ökonomische Modellierung, Ökonometrie (z.B. Regressionsanalyse, lineare Optimierung), Statistik, qualitative Methoden) die Sie anwenden werden. Außerdem sollte das Thema Ihren persönlichen Interessen entsprechen. Diese werden auch durch die im Masterstudium belegten Schwerpunkte und Lehrveranstaltungen sichtbar.
3. Ich habe eine passende Forschungsidee, was nun?
Wenn Sie eine Forschungsidee haben, die den oben genannten Kriterien entspricht, ist der nächste Schritt, sich eineN BetreuerIn für die Arbeit zu suchen. Idealerweise läuft dieser Prozess wie folgt ab:
- Kontaktieren Sie die Person, die Sie betreuen könnte. Wer das ist, hängt von Ihrem konkreten Thema und der Methode, die Sie anwenden möchten, ab (informieren Sie sich z.B. im Boku fis über Forschungsthemen und bereits betreute Masterarbeiten), bzw. bei wem Sie schon entsprechende Lehrveranstaltung besucht haben. Ein E-Mail zum Erstkontakt sollte beinhalten:
- Eine kurze Beschreibung des Themas, das Sie bearbeiten wollen, inkl. einer ungefähren Forschungsfrage und Idee zur Methode bzw. Daten
- Eine Liste an thematisch relevanten (!) Lehrveranstaltungen, die Sie bereits absolviert haben
- IhrE potenzelleR BetreuerIn gibt Ihnen Bescheid, ob eine Betreuung im Prinzip möglich ist, d.h. ob das Thema zu ihrem Forschungsbereich passt, Betreuungskapazitäten vorhanden sind, etc. Das kann auch in einem Gespräch passieren, wo Sie bereits erste Details besprechen.
- Nach einer positiven Rückmeldung gehen Sie wie mit dem/der potenziellen BetreuerIn besprochen vor. Dies kann bedeuten, dass Sie ein Konzept für Ihre Arbeit verfassen bevor Sie Ihre Betreuungszusage erhalten oder dass Sie direkt mit Ihrer Arbeit beginnen. Jedenfalls empfiehlt es sich, einen Zeitplan für Ihre geplante Arbeit aufzustellen.
- Sobald Ihr Thema und Ihre Betreuungsperson bzw. das Betreuungsteam fixiert sind können Sie Ihre Arbeit beim Studiendekanat anmelden. Alle Infos dazu, sowie zu allen weiteren administrativen Aufgaben finden Sie auf den Seiten der Studienabteilung.
- Für eine Masterarbeit sind normalerweise eine Workload von ca. 30 ECTS im Studienplan veranschlagt, das entspricht der Vollzeitarbeitsleistung (40h/Woche) eines halben Jahres. Es wird empfohlen, die Arbeit dann zu beginnen, wenn man sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren und zügig voranbringen kann.
- Ein vorgegebene Wörter- oder Seitenanzahl gibt es nicht, sondern es zählt die inhaltliche Qualität.
- Halten Sie mit Ihrem Betreuer/Ihrer Betreuerin vereinbarte Termine (Abgaben, Gespräche) ein. Im Gegenzug können Sie das auch von Ihrem Betreuer/Ihrer Betreuerin erwarten. Die Betreuungsarbeit richtet sich dabei nach dem Zeitbedarf und den Zeitressourcen des Betreuers/der Betreuerin; nicht nach „dringenden“ Fristen. Planen Sie solche Fristen (z.B. Semesterende) frühzeitig ein und bedenken Sie dabei, dass (gutes) Feedback seine Zeit braucht.
- Wenn Sie selbst Daten erheben, besprechen Sie unbedingt das Erhebungsinstrument (Fragebogen/Interviewleitfaden/…) mit IhreM BetreuerIn und erheben Sie erst dann die Daten, wenn das Instrument ‚abgesegnet‘ ist. Achten Sie dabei auch auf die Vorgaben und Richtlinien bezüglich Datenschutz und guter wissenschaftlicher Praxis (siehe auch Richtlinien des OeAWI)!
- Wenn Sie bei Ihrer Arbeit nicht weiterkommen, versuchen Sie zunächst selbst Lösungen zu finden und kontaktieren Sie erst dann die/den BetreuerIn. Nutzen Sie die Angebote der Bibliothek zum Thema Literaturrecherche, dort vorhandene Bücher/Ratgeber zum Verfassen von Abschlussarbeiten; tauschen Sie sich mit KollegInnen in einer ähnlichen Situation aus, etc. Auch die psychosoziale Beratungsstelle der BOKU und die psychologische Studierendenberatung bietet kostenlose Beratung und Unterstützung an.
- Wenn Sie inhaltliche oder methodische Fragen und Probleme haben, die Sie selbst nicht bewältigen können, dann kontaktieren Sie IhreN BetreuerIn und beschreiben Sie möglichst genau, woran es hapert und was Sie bereits versucht haben, um das Problem zu lösen.
- Sollten Sie Ihre Arbeit an der Masterarbeit für einen längeren Zeitraum unterbrechen müssen (Beruf, Krankheit, etc.) dann geben Sie Ihrem Betreuer/Ihrer Betreuerin Bescheid.
- Sie müssen Ihre Arbeit mindestens einmal im Masterseminar des Instituts präsentieren. Dabei präsentieren Sie Ihren Stand der Dinge zum entsprechenden Zeitpunkt, z.B. detaillierten Forschungsplan und Erhebungsinstrument, erste Ergebnisse, o.ä. Ihre Betreuungsperson wird mit Ihnen einen Termin vereinbaren – meist präsentieren mehrere Studierende gemeinsam, sodass Sie mehrere ZuhörerInnen haben und damit Rückmeldungen bekommen können.
Sonstige FAQs, Informationen und Tipps
Voraussetzungen: je nach Thema und BetreuerIn kann es sein, dass bestimmte LVs (z.B. Ökonometrie, qualitative Methoden, o.ä.) bereits absolviert sein müssen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Betreuungsperson über solche Anforderungen.
Sprache: Die Masterarbeit kann in Deutsch oder Englisch verfasst werden. Sie muss grammatikalisch und orthografisch korrekt sein, ziehen Sie daher ein Lektorat, zumindest durch KI-Tools, in Betracht – Ihre Betreuungsperson übernimmt diese Aufgaben nicht!
KI-Nutzung: Sie können textgenerierende KI Tools für Ihre Arbeit nutzen, um den Schreibprozess oder andere Teile der Arbeit (z.B. Programmieren, Literatursuche) zu unterstützen. Sie müssen generierte Texte jedoch selbst auf Korrektheit überprüfen. Geben Sie zudem in der Arbeit an, wofür Sie welches Tool und an welcher Stelle der Arbeit verwendet haben. Orientieren Sie sich hierbei beispielsweise an den in dieser Vorlage aufgelisteten Teiltätigkeiten einer Abschlussarbeit: https://digital.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/digital/COGNISANCE_Generative_AI_Declaration.docx
Formale Anforderungen:
- Die Masterarbeit soll geschlechtssensibel formuliert sein. Eine „Generalklausel“ (à la „Frauen sind mitgemeint“) zu Beginn der Arbeit ist dafür nicht zu empfehlen. Seien Sie bei der Wahl der Formulierung konsistent, d.h. entscheiden Sie sich für eine Variante der geschlechtsneutralen Formulierung (LandwirtInnen, Landwirt/in, Landwirtinnen und Landwirte, abwechselt männliche und weibliche Form, …) und behalten Sie diese für die gesamte Arbeit bei.
- Achten Sie auf allgemeine Anforderungen für wissenschaftliche Texte: sinnvolle thematische Gestaltung von Absätzen und Unterkapiteln; Erwähnung von Tabellen/Grafiken im Fließtext; Titel von Tabellen und Abbildungen; Kapitelgliederung (nicht zu wenige oder zu viele Gliederungsebenen); keine komplizierte Sprache (vermeiden Sie Schachtelsätze, passive Formulierungen, etc.); etc.
- Korrektes, konsistentes Zitieren der verwendeten Literatur! Erwägen Sie dabei jedenfalls die Verwendung eines Literaturverwaltungsprogrammes. Achtung: jede Abschlussarbeit wird einem Plagiatscheck unterzogen, der auch unterschiedliche Sprachen (Übersetzungen) erkennt!
