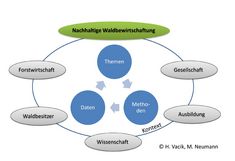In ganz Mitteleuropa nimmt die Bedrohung durch Waldbrände und die daraus resultierende Gefahr für Menschen, Lebensgrundlagen und die Umwelt infolge des Klimawandels zu. Die jüngsten Waldbrände in den Grenzregionen Mitteleuropas haben deutlich gemacht, dass eine bessere Zusammenarbeit, Kommunikation und Information erforderlich sind, sowohl im Hinblick auf die Landbewirtschaftung, die Planung in den Gemeinden als auch auf die Bedürfnisse der Einsatzkräfte. Das Fehlen detaillierter und aktueller Informationen über die Art der Brennstoffe, die Ausbreitung des Feuers, die Zufahrtswege, die Ressourcen für die Brandbekämpfung und die unterschiedlichen regionalen Ansätze zur Bewertung des Risikos von Waldbränden führen zu einer Reihe von Herausforderungen beim Umgang mit dieser Bedrohung. Bislang wurde das Management des Waldbrandrisikos auf territorialer Ebene durchgeführt, wobei die Ansätze für Warnstufen, Landbewirtschaftung und Risikokommunikation nicht aufeinander abgestimmt waren. Die Kartierung des Brennmaterials und des Ausbreitungspotenzials wird nur selten auf territorialer Ebene durchgeführt, geschweige denn grenzüberschreitend. Wildfire CE wird die Charakterisierung des Brennmaterials, das Brandverhalten und das Ausbreitungspotenzial grenzüberschreitend kartieren, ermitteln, wo Maßnahmen erforderlich sind, welche Maßnahmen dies sind, und diese Maßnahmen in den Pilotregionen umsetzen. Die wichtigsten Ergebnisse von Wildfire CE sollen die Umsetzung in den Pilotregionen und die Übertragung der Ansätze auf andere Regionen ermöglichen. Die Unterstützung für das Projekt, seine Ziele und die erwarteten Veränderungen wird auch in den Zuständigkeiten der assoziierten Partner deutlich, zu denen regionale/lokale Behörden, Feuerwehrdienste und Landverwalter gehören, die alle von der erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse profitieren werden. Mit Hilfe dieser assoziierten Partner können ihre Anforderungen an ein besseres Management von Waldbrandrisiken in den Ergebnissen besser dargestellt werden, was eine einfachere Umsetzung und Integration in bestehende Management- und Planungsstrukturen ermöglicht. Das Projekt wird die Art und Weise verändern, wie das Brandrisiko in Grenzregionen und im weiteren Umkreis bewertet und gemanagt wird. Durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und den Austausch von Wissen und Erfahrungen wird es zu einem stärker integrierten, zielgerichteten und integrativen Ansatz im Umgang mit dieser Bedrohung führen.